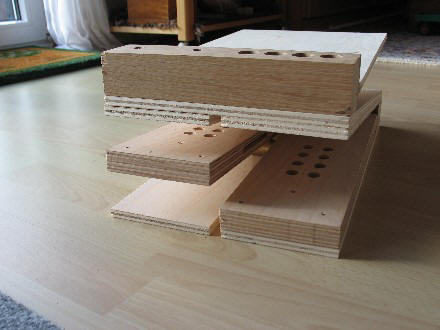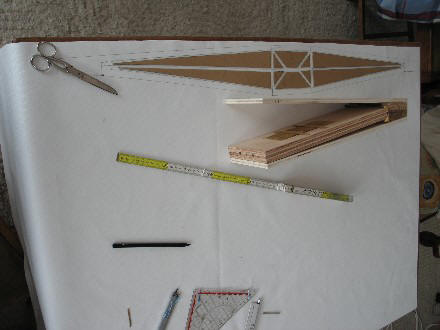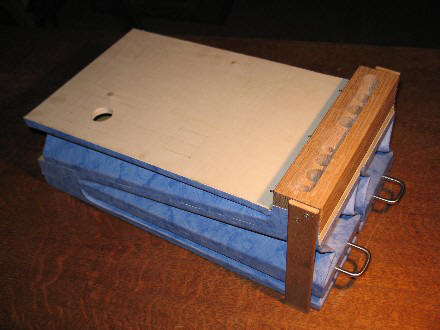Balgensystem
GB: Please,
don't hesitate to ask me...
NL:
Asjeblief, aarzel niet te vragen...
F: Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter...
Siehe auch den Lergeld-Beitrag vom Teammitglied
Klaus: